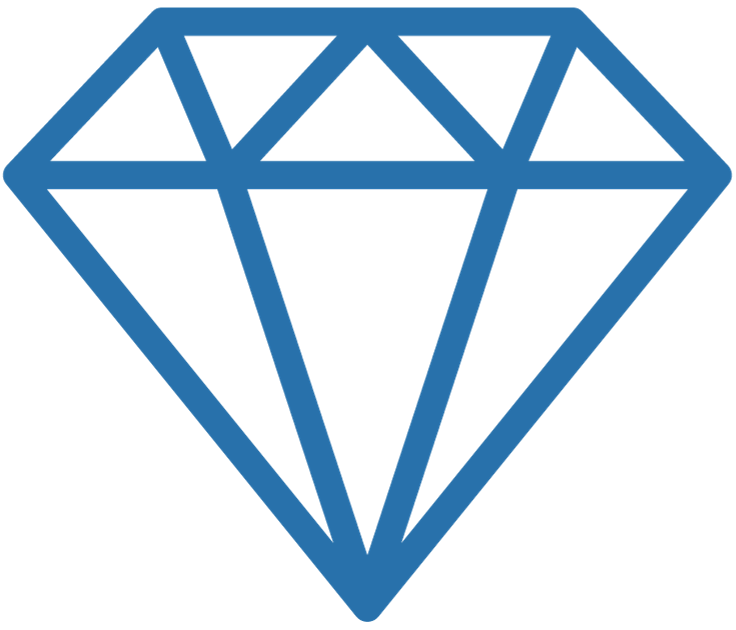Wenn Angehörige Pflege brauchen - Teil 1: Wenn Eltern plötzlich Hilfe brauchen – Warnsignale frühzeitig erkennen
Viele Angehörige merken es zuerst im Alltag: Die Eltern oder Großeltern wirken vergesslicher, ziehen sich zurück oder kommen mit dem Haushalt nicht mehr so gut zurecht wie früher. Oft sind es kleine Veränderungen, die auf eine beginnende Pflegebedürftigkeit hinweisen. In solchen Momenten stellen sich viele Fragen: Was bedeutet das für uns als Familie? Müssen wir jetzt etwas unternehmen – und wenn ja, was?
Dieser Beitrag ist der erste Teil unserer dreiteiligen Serie zum Thema Vorbereitung auf die Pflegebedürftigkeit von Familienmitgliedern. Wir zeigen, wie Sie erste Anzeichen erkennen, rechtzeitig handeln und Schritt für Schritt gute Entscheidungen treffen können – gemeinsam mit Ihren Angehörigen.
Typische Anzeichen für einen wachsenden Unterstützungsbedarf
Nicht jede vergessene Rechnung oder jedes Stolpern auf der Treppe kündigt gleich einen Pflegefall an. Dennoch gibt es Warnsignale, die darauf hinweisen können, dass ältere Menschen im Alltag zunehmend Hilfe benötigen:
Vernachlässigung des Haushalts
Der Müll stapelt sich, das Geschirr bleibt stehen, Kleidung wird seltener gewechselt.
Körperliche Veränderungen
Unerklärliche blaue Flecken (Hinweis auf Stürze), Gewichtsverlust, Nachlassen der Hygiene.
Gedächtnisprobleme
Medikamente werden vergessen, Termine verpasst, der Herd bleibt eingeschaltet.
Sozialer Rückzug
Aktivitäten werden abgesagt, Anrufe werden nicht angenommen, Gespräche wirken orientierungslos oder wiederholen sich.
Verändertes Verhalten
Stimmungsschwankungen, Misstrauen, Reizbarkeit oder Antriebslosigkeit können auf eine beginnende Demenz oder depressive Verstimmung hinweisen.
Natürlich muss nicht jedes dieser Anzeichen gleich Anlass zur Sorge geben, aber in der Summe oder über einen längeren Zeitraum hinweg sind sie ein wichtiges Signal, genau hinzusehen.
Das Gespräch suchen – mit Fingerspitzengefühl
Wenn Ihnen Veränderungen auffallen, ist ein respektvolles Gespräch auf Augenhöhe der nächste wichtige Schritt.
Wählen Sie dafür einen ruhigen Moment ohne Zeitdruck. Machen Sie deutlich, dass es Ihnen nicht um Kontrolle, sondern um Unterstützung und Sicherheit geht.
Vermeiden Sie Vorwürfe, sondern stellen Sie Fragen:
- "Wie geht es dir in letzter Zeit wirklich?"
- "Ist dir aufgefallen, dass du manche Dinge öfter vergisst?"
- "Wäre es vielleicht eine Erleichterung, wenn wir uns manche Aufgaben teilen?"
Geduld ist dabei entscheidend. Manche ältere Menschen lehnen Hilfe zunächst ab – oft aus Angst, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Wichtig ist, ihnen Zeit zu geben und immer wieder Gesprächsangebote zu machen.

Wann professionelle Unterstützung sinnvoll ist
Zeichnen sich dauerhaft Einschränkungen im Alltag ab, sollte frühzeitig externe Beratung hinzugezogen werden.
Hierbei helfen unter anderem:
Pflegestützpunkte in Ihrer Region, die kostenfrei und neutral beraten
Pflegeberatungen
durch Einrichtungen wie die Katholischen Sozialstationen Mittelbaden, die individuell auf Ihre Situation eingehen
Hausärzte, die medizinisch einschätzen können, ob eine Einstufung in einen Pflegegrad sinnvoll ist.
Wer sich rechtzeitig informiert, kann Unterstützungsleistungen beantragen, bevor eine Überforderung entsteht – sowohl bei den Angehörigen als auch bei den Pflegebedürftigen.
Fazit: Frühzeitiges Handeln hilft allen Beteiligten
Der Weg in die Pflegebedürftigkeit beginnt oft mit leisen Signalen. Wer diese wahrnimmt, achtsam anspricht und aktiv wird, schafft die Grundlage für eine gute Versorgung und bewahrt die Selbstbestimmung der Betroffenen. Es lohnt sich, frühzeitig hinzusehen und Hilfe anzubieten, bevor aus kleinen Stolpersteinen große Hürden werden.
Sie vermuten, dass ein Angehöriger zunehmend Unterstützung benötigt? Unsere Fachkräfte der Katholischen Sozialstationen Mittelbaden beraten Sie gerne – einfühlsam, vertraulich und individuell.