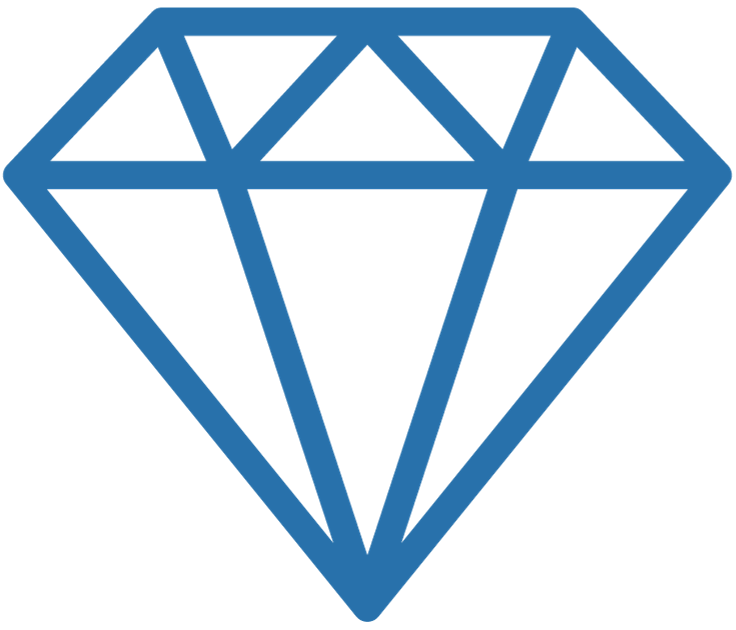Wenn Angehörige Pflege brauchen - Teil 3: Rollentausch – vom Kind zum Unterstützer
Ein Pflegefall in der Familie verändert vieles. Plötzlich werden aus Söhnen und Töchtern Organisatoren, Entscheidungsträger, manchmal sogar Pflegende. Die Rollen verschieben sich – und das oft schneller, als allen Beteiligten lieb ist. Was früher selbstverständlich war, fühlt sich plötzlich anders an: Wenn die eigenen Eltern Hilfe brauchen, entstehen Unsicherheiten, Konflikte, aber auch neue Formen der Nähe.
Im dritten Teil unserer Reihe möchten wir beleuchten, was es emotional bedeutet, wenn erwachsene Kinder Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und wie es gelingen kann, diesen Wandel respektvoll und gemeinsam zu gestalten.
Ein Rollenwechsel, der Zeit braucht
Wenn Eltern pflegebedürftig werden, kehrt sich das Beziehungsgefüge häufig um: Die, die einst für alles gesorgt haben, sind nun selbst auf Hilfe angewiesen. Für viele Angehörige ist das eine ungewohnte, manchmal überfordernde Situation.
Typische Gefühle, die dabei entstehen:
Diese Gefühle sind völlig normal – wichtig ist:
Sie dürfen ausgesprochen werden. Der Rollenwechsel gelingt besser, wenn sich Angehörige bewusst machen, dass es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt, sondern viele kleine Schritte hin zu einem neuen Miteinander.
Wertschätzung und Verantwortung
Pflege bedeutet nicht, die Eltern zu entmündigen, sondern ihnen zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben.
Gerade wenn Entscheidungen anstehen (z. B. einen Pflegegrad zu beantragen, Haushaltshilfe organisieren oder eine Vorsorgevollmacht einzurichten), sollten Angehörige ihre Unterstützung immer als Angebot formulieren, nicht als Anordnung.
Sätze wie:
„Was ist dir wichtig, wenn du mal Hilfe brauchst?“ oder
„Lass uns das gemeinsam anschauen, damit du weiter entscheiden kannst." zeigen, dass die
Würde und die Autonomie der Eltern im Mittelpunkt stehen. Denn auch wer Unterstützung braucht, möchte ernst genommen werden, gerade von der eigenen Familie.

Konflikte und alte Muster: Wenn Pflege alte Wunden berührt
Pflegesituationen können auch alte Familienkonflikte neu aufbrechen. Wer übernimmt wie viel? Warum kümmert sich der eine mehr als der andere? Oder: Warum fällt es so schwer, Hilfe anzunehmen?
Gerade in solchen Situationen kann es helfen:
- bewusst innezuhalten und sich gegenseitig zuzuhören,
- Aufgaben klar zu verteilen – auch mit externer Hilfe (z. B. Pflegeberatung),
- sich Unterstützung zu holen, etwa durch ambulante Dienste oder professionelle Entlastungsangebote.
Denn nicht alles muss innerhalb der Familie gelöst werden. Oft hilft der Blick von außen, um eingefahrene Muster zu durchbrechen.

Gemeinsam durch eine neue Lebensphase
Pflege kann fordern aber auch verbinden. Wenn Angehörige zusammenhalten, Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird und Raum für Gespräche bleibt, entstehen neue Formen der Nähe.
Manchmal ergeben sich auch ganz neue Rituale: Gemeinsame Spaziergänge, neue Gespräche, das Teilen von Erinnerungen.
Wer sich bewusst mit der neuen Situation auseinandersetzt, erlebt: Auch wenn sich Rollen verändern – die Beziehung bleibt. Nur anders.
Fazit: Pflege verändert Beziehungen – aber sie muss sie nicht belasten
Die Pflege eines Angehörigen bringt emotionale Herausforderungen mit sich. Sie stellt Beziehungen auf die Probe, eröffnet aber auch neue Wege der Verbindung. Wichtig ist, diesen Prozess bewusst zu gestalten, Verantwortung zu teilen und sich auch selbst nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn gute Pflege beginnt mit gegenseitigem Respekt und dem Mut, neue Rollen anzunehmen.
Sie stehen am Anfang einer Pflegesituation in Ihrer Familie?
Unsere Pflegeberaterinnen und -berater der Katholischen Sozialstationen Mittelbaden begleiten Sie mit Herz und Erfahrung, damit Sie als Familie einen guten Weg finden.